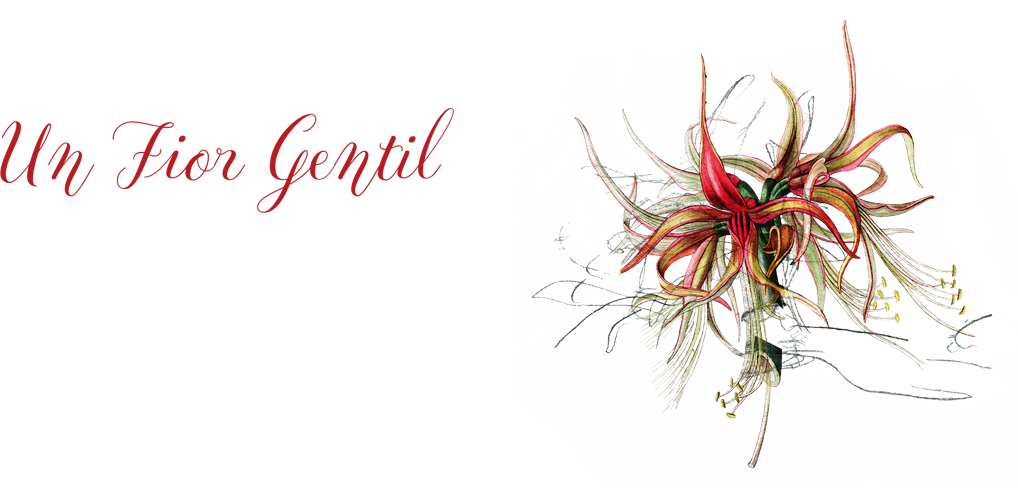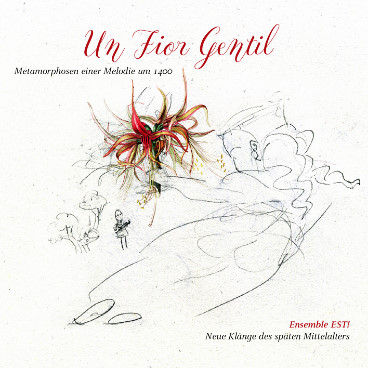Über das Projekt
VON PETER NEUBÄCKER
Das Projekt „Un Fior Gentil“ hat eine lange und ungewöhnliche Geschichte, die eng mit der Musikbearbeitungssoftware „Melodyne“ verbunden ist. Als ich Ende der 90er Jahre diese Software entwickelte, hatte ich eine Vision auf ganz neue Art mit aufgenommener Musik umzugehen: Bis dahin war die Aufnahme eines Musikstückes der letzte Schritt der musikalischen Arbeit - man konnte bei Bedarf zwar noch schneiden oder einfache klangliche Bearbeitungen vornehmen, aber die Musik nicht mehr musikalisch-kompositorisch umgestalten - die Musik war nach der Aufnahme gewissermaßen „eingefroren“.
die Musik war nach der Aufnahme gewissermaßen „eingefroren“. Mit Melodyne wird die Aufnahme wieder „aufgetaut“
Mit Melodyne wird die Aufnahme wieder „aufgetaut“: die Melodien werden analysiert und alle Noten mit ihren feinsten Phrasierungen angezeigt - diese Noten kann der Benutzer „anfassen“ und auf beliebige Art in Tonhöhe, Dauer oder Klang verändern oder sie ganz „umsortieren“. Die aufgenommene Musik wird so zum „Spielmaterial“, und die kreative Arbeit des Komponierens und Arrangierens kann auch nach der Aufnahme weitergeführt werden.

Peter Neubäcker
Als das Programm Melodyne 2000 kurz vor der Veröffentlichung stand, hatten wir die Idee, eine umfangreiche Aufnahme von Musik als „Testprojekt“ zu machen: Um Material zur Verfügung zu haben, um die konkrete Anwendung der Software auszuprobieren und ein ganzes Album zu produzieren, auf dem die kreativ-kompositorischen Möglichkeiten des neuen Umgangs mit der Musik ausgeschöpft werden.
Da traf es sich gut, daß unser Freund Walter Waidosch gerade mit musikalischen Forschungen beschäftigt war zu dem Album „Un Fior Gentil“ für sein Ensemble „EST!“, in dem ich auch gelegentlich mitgespielt hatte. Als ich ihm von Melodyne und seinen musikalischen Möglichkeiten erzählt hatte, beschlossen wir, das Album so einzuspielen, daß es mit diesem neuen Werkzeug bearbeitet werden kann.
Damit die Musik mit Melodyne bearbeitet werden konnte, waren einige Voraussetzungen zu beachten: So war es nötig, daß jede Melodiestimme auf einer eigenen Spur aufgenommen wird, auf der die anderen Instrumente nicht zu hören sind, und außerdem durfte jedes Instrument oder jede Stimme nur einstimmig gespielt sein, da Melodyne - zumindest damals - nicht für polyphone Instrumente geeignet war. Walter hat alle Stücke des Albums so arrangiert, daß diese Voraussetzungen gegeben waren.
Wir gingen mit dem Ensemble Anfang des Jahres 2001 in das Tonstudio von Ulrich Kraus am Wörthsee. Die Aufnahmen waren ein recht aufwendiger Prozeß: Zunächst wurde jedes Stück von dem Ensemble als ganzes „live“ aufgenommen. Da es aber notwendig war, jede Stimme auf einer eigenen Spur zu haben, wurden diese ersten Aufnahmen für das Ergebnis gar nicht verwendet - sie dienten nur dem jeweiligen Spieler als Orientierung, die er über Kopfhörer zugespielt bekam, um seine Stimme einzeln noch einmal einzuspielen.
Dieses Vorgehen ist zwar bei Pop-Produktionen das Normale, aber für die „klassischen“ Musiker sehr ungewohnt und war für die Künstler eine große Herausforderung.
Dieses Vorgehen ist zwar bei Pop-Produktionen das Normale, aber für die „klassischen“ Musiker sehr ungewohnt und war für die Künstler eine große Herausforderung. Für den Chor gab es eine Kompromißlösung: Alle Kinder sangen gemeinsam, aber jedes hatte sein eigenes Mikrofon und bekam die Ensembleaufnahme über Kopfhörer zugespielt, und zwischen ihnen waren akustische Trennwände aufgestellt.
Als die Aufnahmen fertiggestellt waren, machte ich mich an die Bearbeitung - und mußte zu meiner Enttäuschung feststellen, daß es doch nicht so einfach war, wie ich mir vorgestellt hatte: Zum einen waren die Algorithmen zur Wiedergabe der bearbeiteten Klänge für einige Instrumente noch nicht so ausgereift, daß sie unseren Ansprüchen entsprechen konnten, zum anderen stellte sich heraus, daß einige Instrumente unbeabsichtigt doch mehrstimmig waren, so zum Beispiel der Psalter, dessen Melodien zwar monophon „gemeint“ waren, aber durch das lange Nachklingen der angeschlagenen Saiten das Ergebnis dann doch polyphon war - womit die Software damals noch nicht umgehen konnte. Außerdem war ich, nachdem die Software dann 2001 veröffentlicht war, so intensiv mit der Weiterentwicklung von Melodyne beschäftigt, daß ich auch einfach keine Zeit mehr hatte, mich dem musikalischen Projekt zu widmen - so wanderte es erst einmal in die Schublade - und dort blieb es dann viele Jahre liegen.

Der Anfang der Melodie „Un Fior Gentil“ …
Unsere Software wurde in den folgenden Jahren dann immer weiter entwickelt und verbessert - so lernte das Programm 2009 auch mit mehrstimmigen Aufnahmen umzugehen, und die Arbeitsweise und die Klangwiedergabe wurden perfektioniert.
Es sind dann doch fast 20 Jahre seit den Aufnahmen vergangen, bis wir sie aus der Schublade hervorholten und uns mit Freude an die musikalische Gestaltung begaben.
Endlich waren die Voraussetzungen gegeben, die die Arbeit an unserem Projekt „Un Fior Gentil“ ermöglichten. Es sind dann doch fast 20 Jahre seit den Aufnahmen vergangen, bis wir sie aus der Schublade hervorholten und uns mit Freude an die musikalische Gestaltung begaben. Das Ergebnis ist jetzt auf diesem Album zu hören.

… und die Analyse der Gesangslinie in Melodyne
Beim Anhören der ursprünglichen Aufnahmen waren wir erstaunt, welche Schätze mittelalterlicher Musik da so lange geschlummert hatten. Bei manchen Stücken hatten wir gar nicht das Bedürfnis, viel zu verändern oder anders zu arrangieren - diese blieben dann im Wesentlichen so, wie sie eingespielt waren, und die Möglichkeiten von Melodyne wurden nur genutzt, um den den Klang möglichst schön und transparent zu gestalten. Bei anderen Stücken wurden einige Stimmen in der Tiefe oder in der Höhe verdoppelt, um mehr Breite im klanglichen Arrangement zu erhalten. Bei wieder anderen wurde der Klang der Instrumente drastischer verändert, um dem Hörer einen geheimnisvollen Klang zu präsentieren von Instrumenten, die es so gar nicht gibt. Der Vorteil in der Gestaltung der Klänge mit Melodyne auf der Basis echter gespielter Instrumente liegt darin, daß bei beliebiger Klangveränderung die natürliche Phrasierung des Musikers erhalten bleibt - im Gegensatz etwa zur Verwendung von Synthesizern.
So wurde zum Beispiel in "Medée Fu" (4) aus der Flötenstimme ein heiserer Klang gestaltet, der den geheimnisvollen Wahnsinn der Medea andeutet, und die begleitenden Streichinstrumente wurden mit einem gläsernen Klang gefärbt. Bei mehreren Stücken wurden die Noten der Trommeln so transponiert, daß sie eine Melodielinie mitspielen, wie bei "Una Cosa di Veder" (8) oder "Aquil Altera" (12). Die extremste Bearbeitung hat das Stück "De ma Dolour" (9) erfahren: Die Gesangsstimme wurde angerauht, um den Ausdruck des Schmerzes zu verstärken, und die Begleitstimmen wurden vielfach mit verfremdeten Klängen gedoppelt oder mit dem Originalklang des Gesangs gefärbt. Das verbindende Element zwischen den Stücken bildet der Klang einer Tanpura - das Instrument der indischen Musik, das den Klang der Ewigkeit repräsentiert, aus dem alle Noten hervorgehen - auf die dorische Tonalität der Musik adaptiert und ihre strahlenden Obertöne dynamisch ausgebreitet.
Website der Musikbearbeitungssoftware „Melodyne“:
https://www.celemony.com/